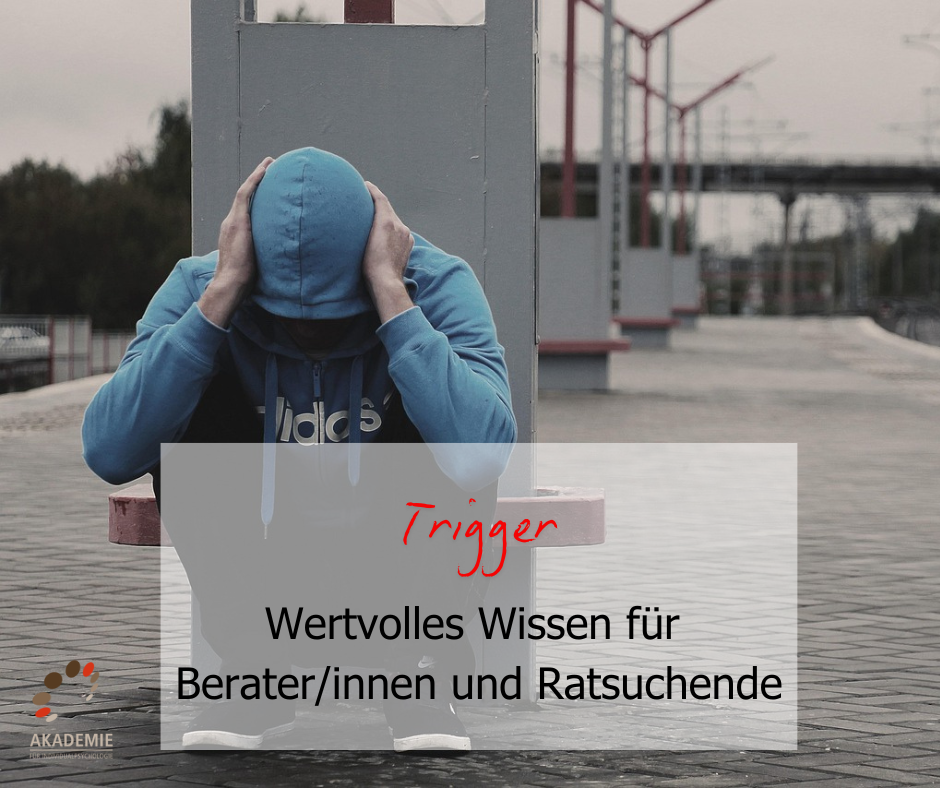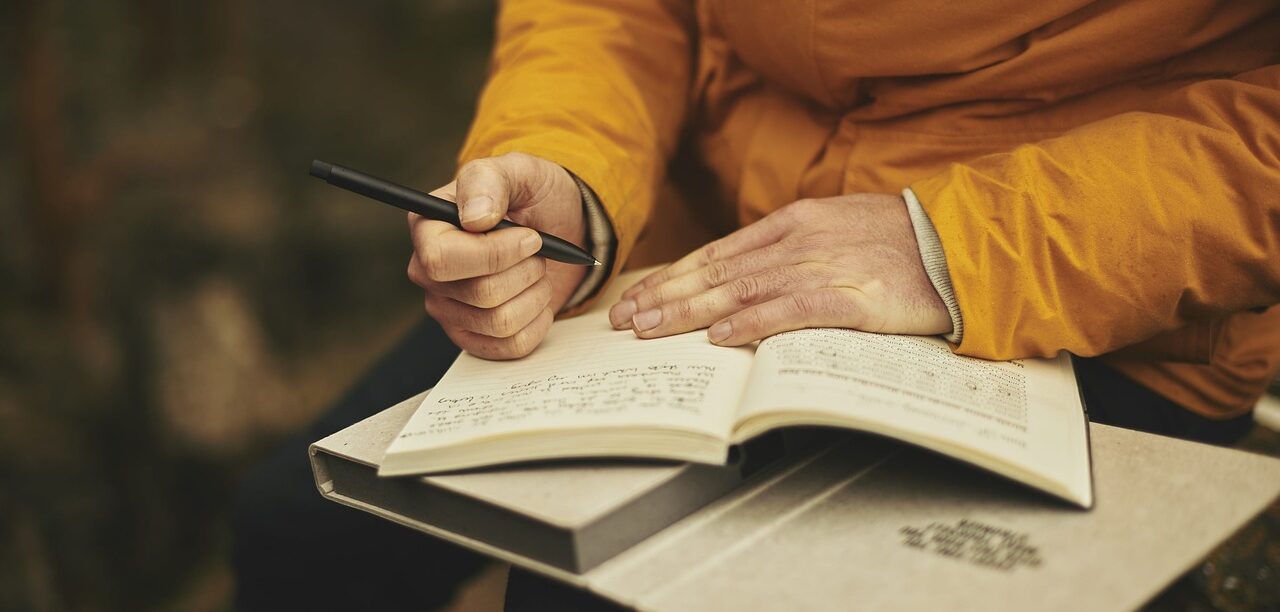Trigger in der Psychologie – Wertvolles Wissen für Berater/innen und Ratsuchende
„Triggerwarnung“ – diesen Hinweis haben Sie bestimmt schon bei Podcasts, vor Online-Beiträgen oder Filmen gesehen. Er soll Nutzer/innen auf belastende Inhalte hinweisen. Der Begriff wird inzwischen so häufig verwendet, dass seine wahre Bedeutung zunehmend an Schärfe verliert. Dieser Beitrag erklärt, was der Begriff Trigger wirklich bedeutet und er bietet konkrete Strategien, die Sie im Umgang mit Triggern unterstützen.
Noch ein Hinweis: Traumata stellen eine enorme psychische Belastung dar. Sie müssen den Weg zur Heilung nicht alleine bewältigen. In Notfällen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder eine psychiatrische Ambulanz.
Trigger verstehen – die psychologischen Grundlagen
Trigger ist ein Begriff aus der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Er bezeichnet einen Reiz, der untere anderem Flashbacks auslöst. Flashbacks gelten als Symptom einer Posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. Falkai et al., 2018, S. 361ff.) Sie sind eine spezielle Form der Erinnerung (Intrusion), die das Bewusstsein der Betroffenen für den gegenwärtigen Augenblick trüben.
Trigger oder Erinnerung: Wo liegt der Unterschied?
Im Gegensatz zur Erinnerung (Intrusion), können Betroffene eines Flashbacks vorübergehend den Bezug zur Realität verlieren.
Beispiel: Paul P. (63 Jahre) war in einen schweren Autounfall verwickelt. Er erlitt eine lebensbedrohliche Lungenquetschung und einen Milzriss. Trotz der schweren Verletzungen war er bei Bewusstsein und spürte Todesangst. Bei der Befragung zum Unfallhergang gab er an, dass er vor dem Aufprall laut quietschende Reifen und das Knirschen von Metall gehört hatte. Zwei Jahre nach dem Vorfall sitzt Paul P. auf einer Parkbank, als er das Geräusch laut quietschender Reifen in unmittelbarer Nähe wahrnimmt. Der Fahrer eines Lieferwagens hatte eine rote Ampel übersehen und vollzog eine Vollbremsung.
Das Geräusch der quietschenden Reifen löst bei Paul P. einen Flashback aus:
- Visuell: Vor P.s innerem Auge tauchen Bilder des Unfalls auf, wie er sich der Windschutzscheibe nähert und auf das vor ihm fahrende Auto zubewegt.
- Auditiv: Das Knirschgeräusch des Metalls wiederholt sich in seinem Kopf und verbindet sich mit dem Geräusch der bremsenden Reifen in der Gegenwart.
- Emotional: Paul P. erlebt intensive Angst und Panik, sein Herz rast, er schwitzt und fühlt sich hilflos.
- Körperlich: Sein Brustkorb schmerzt, als würde seine Lunge wieder zusammengedrückt.
- Kognitiv: Er denkt „Ich werde sterben.“
Paul P. verliert die reale Situation kurzzeitig aus den Augen. Er erlebt die Gegenwart, als würde der Unfall gerade stattfinden. Das Quietschen der Reifen fungiert in diesem Fall als Trigger, der mit seinem Trauma verbunden ist.
Während der Ausdruck „Das triggert mich“ im allgemeinen Sprachgebrauch das Wiederaufleben negativer Erfahrungen beschreibt, teilen Flashbacks und Erinnerungen die gleichen psychologischen Grundlagen.
Grundlagen von Triggern und Erinnerungen: Lernprozesse
Trigger und Erinnerungen basieren beide auf Erfahrungen und Lernprozessen.
In unserem Trauma-Beispiel von Paul P. hat sich folgender Lernprozess abgespielt: Der ursprünglich neutrale Reiz „quietschende Reifen“ trat fast zeitgleich mit dem Aufprall des Unfallwagens auf das Auto von Herrn P. auf. Der Aufprall verursachte bei Paul P. Todesangst und starken Druckschmerz in der Brust. Das Gehirn stellte zwischen diesen Ereignissen – quietschende Reifen und Aufprall – eine Verbindung her. Die Psychologie nennt diese Art des Lernens klassische Konditionierung (vgl. Wirtz, 2025). Der Prozess, in dem das Gehirn die Gefühle und Eindrücke mit einem Ereignis verknüpft, heisst Assoziation.
Verschiedene Arten von Triggern
Grundsätzlich können alle Reize, die während eines traumatischen Ereignisses vom Gehirn gespeichert wurden, zu einem Trigger werden. Zu den häufigsten Triggern zählen:
- Sinneswahrnehmungen (Gerüche, Geräusche, Bilder, Berührungen, Geschmack)
- Orte
- Personen oder Personengruppen
- Jahrestage oder besondere Daten
- Medieninhalte (Filme, Nachrichten, soziale Medien)
- Gedanken und Selbstgespräche
- Körperliche Empfindungen (z.B. Müdigkeit, Hunger, Anspannung)
- Emotionale Zustände (z.B. Angst, Trauer, Wut)
Je traumatischer eine einzelne Situation wahrgenommen wird, umso tiefer sind die Spuren, die es im Gehirn hinterlässt. Auch sich wiederholende Erlebnisse, wie Gewalterfahrung oder emotionale Vernachlässigung prägen sich tief ins Bewusstsein. Entsprechend intensiv erleben die Betroffenen Flashbacks als Reaktion auf einen Trigger und die Heilung erfordert Geduld.
Trigger erkennen – mit diesen Methoden
Um Trigger eindeutig zu identifizieren, haben sich verschiedene Methoden als hilfreich erwiesen.
- Das Triggertagebuch: Nutzen Sie ein kleines Notizbuch oder eine App, um Auslöser zu erkennen. Dokumentieren Sie die Situationen, in denen Flashbacks auftreten mit einer Bewertung ihrer Dauer, der Stärke und der jeweiligen Symptome.
- Gespräche mit Vertrauenspersonen: Fragen Sie Personen, denen Sie vertrauen und in deren Gegenwart Sie bereits einen Flashback erlebt haben, nach deren Einschätzung. Notieren Sie auch diese Erkenntnisse in dem Tagebuch.
- Reflexion mit einer Fachperson: Alfred Adler ging davon aus, dass der Lebensstil die Wahrnehmung eines Menschen beeinflusst. Folglich hängt davon auch die Verarbeitung der traumatischen Erfahrung ab. Der Lebensstil wird vor allem in der Kindheit geformt und kann verändert werden. In einer Atmosphäre, die von Respekt und Ermutigung getragen ist, können Sie sich mit einer individualpsychologischen Beratungsperson ihrer Lebensgeschichte nähern und destruktive Denkmuster analysieren und neu formen.
Umgang mit Triggern: wirksame Strategien
Ein Hinweis vorab: Wenn Sie an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden oder dies vermuten, sollten Sie sich an einen Arzt, eine Ärztin oder psychologische Fachperson Ihres Vertrauens wenden. Ohne professionelle Unterstützung lassen sich Traumata nur schwer heilen.
Eine erste und hilfreiche Reaktion auf Trigger ist die Vermeidung des auslösenden Reizes, wann immer dies möglich ist. Auf Dauer lassen sich viele Trigger nicht umgehen. Ausserdem schränken sie die Lebensqualität ein und es ist wichtig, weitere Strategien zu erarbeiten. Schon die Entscheidung, den Triggern und deren Folgen entgegenzutreten, setzt Energie frei und reduziert Ihr Gefühl von Hilflosigkeit.
Genauso wichtig ist Selbstmitgefühl. Gehen Sie verständnisvoll und behutsam mit sich um – wie ein guter Freund oder die beste Freundin. Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Reaktion auf das traumatische Ereignis normal ist und verurteilen Sie sich nicht dafür. Planen Sie gezielt Dinge, die Ihnen gut tun. Machen Sie sich selbst eine Freude.
Die folgenden Methoden sollten Sie unter professioneller Anleitung durchführen:
- Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen: Sie lernen Schritt für Schritt, Ihre Reaktion auf einen Trigger bewusst wahrzunehmen, ohne sofort darauf zu reagieren. Sie lernen dabei, die Situation auszuhalten.
- Distanzierungstechniken: Sie sind Teil der Akzeptanz. Sie lernen, zum Beispiel mit Atemübungen oder Erdungstechniken, sich emotional von der unmittelbaren Reaktion zu distanzieren.
- Kognitive Umstrukturierung: Gemeinsam mit Ihrer Beratungsperson analysieren Sie die negativen Gedankenmuster, die durch den Trigger ausgelöst werden und bewerten sie neu.
- Exposition: Sie nähern sich kontrolliert und in kleinen Schritten den Triggern. Dieses Vorgehen entspricht einer emotionalen Desensibilisierung.
Sie sind auf der Suche nach einer professionellen Beratung? Hier finden Sie eine Übersicht von diplomierten psychosozialen Berater/innen. Sie alle haben ihre Ausbildung an der Akademie für Individualpsychologie erfolgreich absolviert.
Quellen:
Falkai, P.; Wittchen, H.-U. et al. (2018). American Psychiatric Association. Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5®. Hogrefe Verlag.
Wirtz, M. A. Hg. (2025). Dorsch. Lexikon der Psychologie. Online-Ausgabe. https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/konditionierung-klassische . Abgerufen am 08.05.2025
Autorin:
Mag. Susanne Schmieder (Psychologin)
Susanne Schmieder kennt und schätzt die Individualpsychologie seit ihrem Studium. Sie hat sich theoretisch mit Alfred Adlers Konzept befasst und weiss aus eigener Erfahrung, dass die Individualpsychologie unzählige wertvollen Impulse für die persönliche Entwicklung bereit hält.
Berater/in finden oder einen qualifizierten Abschluss in Individualpsychologie erwerben
Wünschen Sie sich Unterstützung bei der Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung oder möchten Sie selber Menschen unterstützen ihre Persönlichkeitsentwicklung zu fördern?
Ausbildung zum/zur individualpsychologischen Berater/in AFI
Die Akademie für Individualpsychologie (AFI) bietet eine 3-jährige berufsbegleitende Ausbildung dazu an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den eidgenössisch anerkannten Titel «Berater/in im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom HFP» zu erwerben. Eine Anerkennung durch den Berufsverband mit dem Qualitätslabel psychosoziale/r Berater/in SGfB steht nach der Ausbildung ebenfalls offen.
Hier geht es zum nächsten Infoanlass
Berater/in finden
Hier finden Sie individualpsychologische Berater/innen in Ihrer Region.
INFOVERANSTALTUNG BESUCHEN
BROSCHÜRE HERUNTERLADEN
EINBLICK INS STUDIUM – STUDIERENDE BERICHTEN