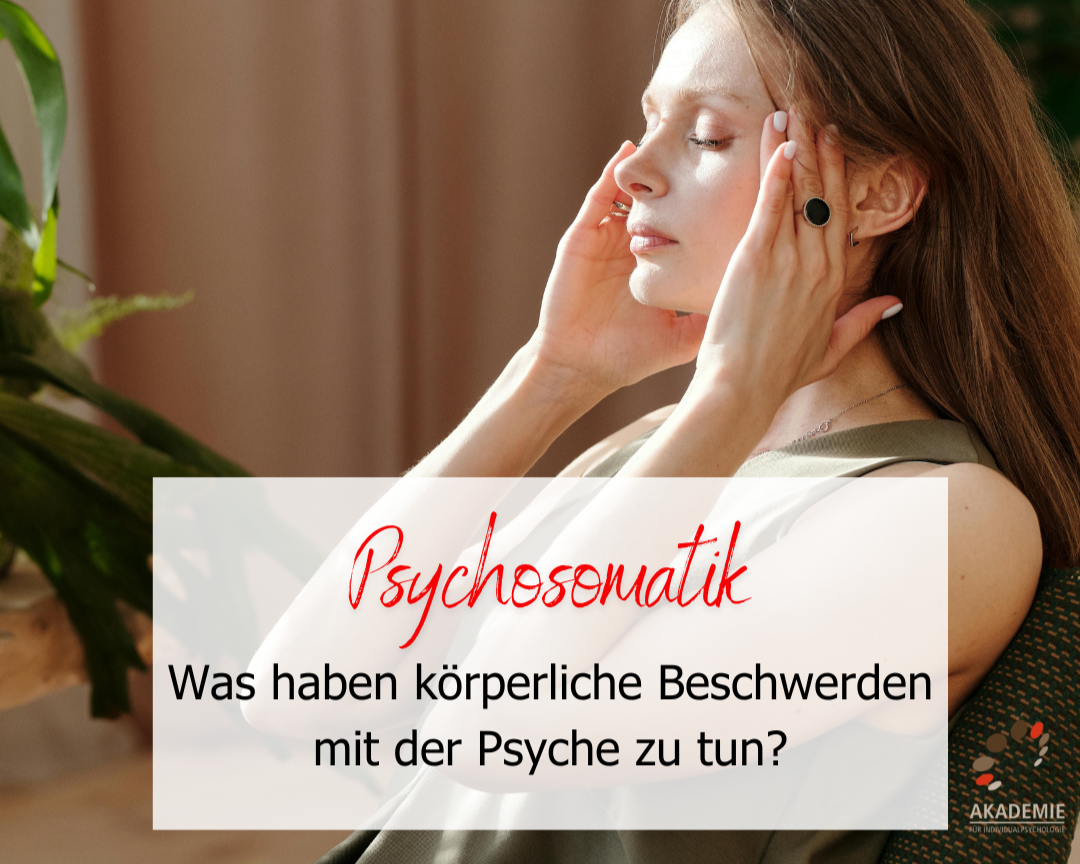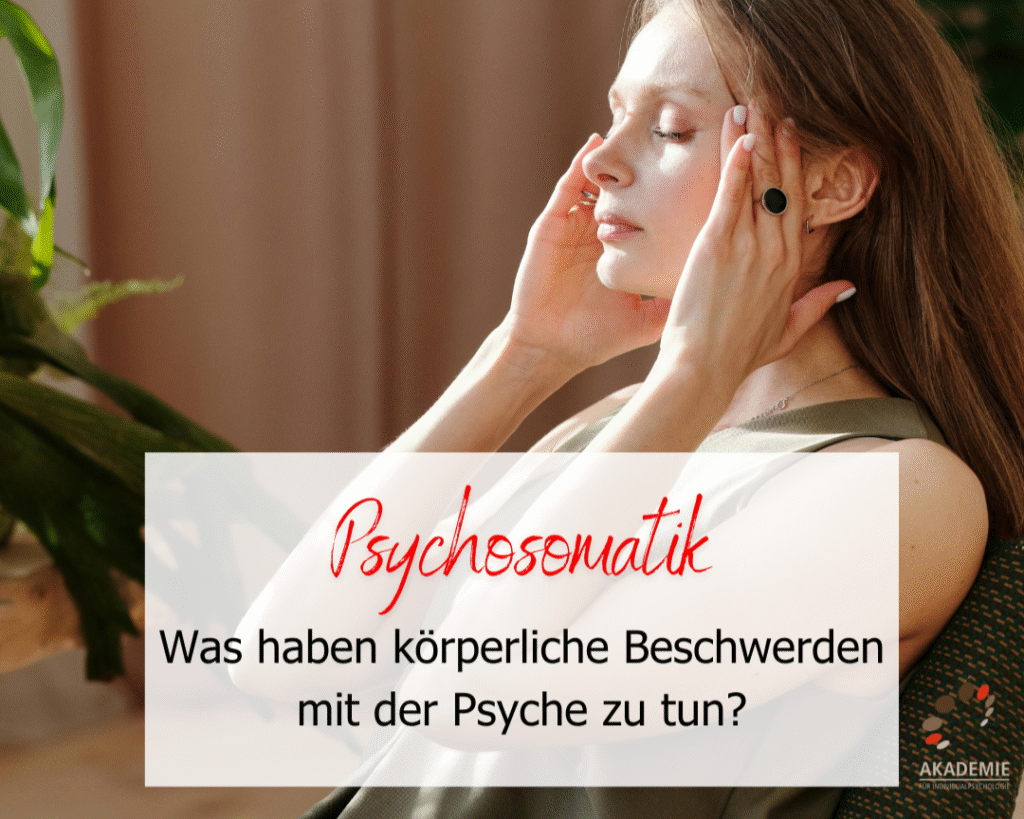Psychosomatik in der Individualpsychologie – was können körperliche Symptome mit der Psyche zu tun haben?
„Was ist die Haltung der Individualpsychologie zur Psychosomatik?“ Manchmal spricht unser Körper eine ganz eigene Sprache: Ein Ziehen im Rücken, ein nervöser Magen oder ein unerklärlicher Juckreiz tauchen genau dann auf, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Die Individualpsychologie sieht in solchen Beschwerden, sofern sie keine medizinische Ursache haben, keine zufälligen Störungen, sondern Hinweise auf das, was in unserem Inneren nach Aufmerksamkeit verlangt. Sie versteht den Menschen als untrennbare Einheit von Körper und Seele – und ermutigt uns, die Signale des Körpers nicht zu übergehen, sondern ihnen mit Neugier und Achtsamkeit zu begegnen. So können wir beginnen, Symptome nicht nur als Last zu sehen, sondern auch als Wegweiser für unser seelisches Wohlbefinden. In diesem Artikel gehen wir den körperlichen Symptomen auf die Spur und zeigen auf, wie man sie erkennen und was man dagegen tun kann.
Kennst du das auch?
Der Rücken schmerzt, obwohl keine ausserordentliche körperliche Belastung bekannt ist, der Magen rebelliert – genau vor einem wichtigen Gespräch oder die Haut juckt ohne bekannte Ursache. Solche Signale, welche uns der Körper sendet, sind selten zufällig. Hier wird uns klar, dass unser Körper mit unserer Innenwelt enger verbunden ist, als wir oft wahrhaben wollen. Schon Alfred Adler erkannte um 1900, dass körperliche Symptome nicht losgelöst von seelischem Erleben sind. In seinem Buch «der nervöse Charakter» (1912) beschreibt er, dass seelische Konflikte (z.B. Minderwertigkeitsgefühle, Angst vor Versagen, sich in körperlichen Symptomen zeigen können. Auch eine zentrale Grundannahme Adlers: «Der Mensch ist eine unteilbare Einheit». Diese Aussage bringt auf den Punkt, dass Körper und Psyche immer in wechselseitiger Beziehung stehen. Damit gilt Adler auch als Pionier -als einer der frühen Wegbereiter für die heutige Psychosomatik. Somit könnte man sagen, dass körperliche Beschwerden als «Sprache der Seele» gesehen werden können.
Was versteht die Individualpsychologie unter Psychosomatik?
Wenn wir also Adlers Gedanken übersetzen, wird schnell deutlich, dass wir nicht isoliert auf unsere Symptome blicken können. Wenn wir körperliche Beschwerden rein medizinisch betrachten, bleibt der Blick oft auf die Symptomebene beschränkt. Schmerzmittel helfen dann vielleicht kurzfristig, aber die eigentliche Botschaft des Körpers bleibt ungehört.
Diese Signale deines Körpers sind Einladungen, genauer hinzuschauen. Wo darfst du dich also liebevoll dir selbst zuwenden und erforschen, was im Aussen oder im Inneren nach Veränderung ruft?
Wenn beispielsweise jemand unter chronischen Magenproblemen leidet, fragt die Individualpsychologie:
- «Welche Konflikte werden heruntergeschluckt?»
- Bei Rückenproblemen; «Welche Last trägst du, die vielleicht gar nicht deine ist?»
- «Was sind die Botschaften, welche mir mein Körper mitteilen möchte?»
- «Welche ungelösten Konflikte oder Belastungen melden sich hier?»
- «Wo übergehe ich meine Grenzen?»
Wieso ist es wichtig auf unsere körperlichen Schmerzen zu hören?
Wenn wir die Signale unseres Körpers überhören, können in der Folge chronische Erkrankungen entstehen. Es bietet sich also die Chance, sich grundlegend mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht bereits erlernte ungünstige Strategien oder Muster aufzudecken.
Wenn wir Zusammenhänge verstehen, fällt es uns auch leichter unseren Körper (wieder) als «Freund» und «Wegweiser» und weniger als «Feind» zu sehen. Denn er tut immer etwas für uns und nicht gegen uns. Wir kämpfen also nicht länger gegen ein Symptom, welches uns Beschwerden macht, sondern sehen einen wohlwollenden Nutzen. So kann sich auch ein ungünstiger Kreislauf aufhalten lassen – denn, wenn es uns körperlich nicht gut geht, schlägt dies auch auf unser Gemüt und umgekehrt.
Der Körper als Speicher von Erlebnissen
Wenn wir uns mit der Weiterentwicklung mit Fokus auf unser Nervensystem befassen, sind weitere spannende Erkenntnisse möglich. Denn jedes Gefühl, jeder Gedanke und Bewertungen, zeigen sich auch körperlich. Emotionale Erfahrungen – insbesondere, wenn sie belastend und überwältigend waren, hinterlassen Spuren.
Diese können lange zurückliegen und uns gar nicht bewusst sein. Doch unsere Körper speichert diese Erfahrungen ab. Diese somatischen Marker sind folglich in unserem Nervensystem gespeichert und beeinflussen automatische körperliche Reaktionen. Diese können sich dann folglich als Anspannungen der Muskeln, Magenprobleme oder anderweitige körperliche Beeinträchtigungen zeigen. Um darauf Einfluss nehmen zu können ist es wichtig, dass wir über diese Wechselseitigkeit Bescheid wissen.
Zusammengefasst können wir also sagen: psychische Belastungen hinterlassen Spuren im Körper, und körperliche Reaktionen beeinflussen wiederum unsere Emotionen und unser Verhalten. Und damit bietet sich ein unfassbar grosser Schatz an zwei Hauptzugängen bzw. Wirkfaktoren – einerseits direkt über den Körper und unser Nervensystem oder über die Kognition, also Glaubenssätze, verinnerlichte Überzeugungen oder Gedanken.
Handlungsmöglichkeiten entdecken
Ein zentrales Element ist, dass wir in die Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung kommen dürfen und erkennen, dass wir nicht ausgeliefert sind. Ganz im Sinne Adlers, der stets betont hat, dass wir nicht determiniert sind. Also nicht Opfer von Umständen oder Begebenheiten sind, sondern Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Leben haben.
Und dennoch darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass körperliche Symptome auch medizinische Ursachen haben können, welche eine entsprechende Abklärung benötigen.
Wenn diese Ebene in einem ersten Schritt berücksichtigt worden ist, dürfen wir uns durch individualpsychologisches Wissen unterstützen lassen:
- Gespräch und Reflexion
- Welche Bedeutung hat das Symptom für dich?
- In welchen Situationen tritt es auf?
- Welche Kindheitserfahrungen könnten darauf hinweisen?
- Wo setze ich keine Grenzen, was befürchte ich?
- Arbeit mit Glaubenssätzen und Antreibern
- B. Ich muss es perfekt machen
- Ich darf keine Hilfe in Anspruch nehmen
- Ich bin nicht gut genug
Diese Haltungen prägen unsere Sicht auf die Dinge und auf unser Verhalten und können Symptome begünstigen.
- Lebensstilarbeit
- Welche unreflektierten Prägungen aus der Kindheit sind im heute noch wirksam?
- Körperorientierte Ansätze
- Atemübungen, Regulation des Nervensystems, Selbstfürsorge, Embodiment
Die Kraft der Selbstregulation für deine Balance
Was bedeutet Selbstregulation im Kern? Und wie können wir diese Fähigkeit nachhaltig stärken? Was ist Selbstregulation wirklich?
Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, den eigenen inneren Erregungszustand bewusst zu beeinflussen – auch dann, wenn im Inneren oder im Aussen gerade viel los ist. Es bedeutet, Zugang zum eigenen Nervensystem zu haben und in einem guten Kontakt mit sich selbst zu bleiben – ohne von Emotionen überwältigt zu werden. Diese Fähigkeit ist tief verknüpft mit zwei zentralen menschlichen Grundbedürfnissen:
- Autonomie – das Gefühl, selbstwirksam zu sein
- Verbundenheit – die Fähigkeit, in Beziehung zu bleiben
Wenn wir reguliert sind, erleben wir genau das: Offenheit, Präsenz, innere Sicherheit. Wir können fühlen, denken, entscheiden – statt nur zu reagieren. Wenn Regulation fehlt, fehlt diese Fähigkeit, und wir geraten in eine Dysbalance:
- Übererregung: ständige innere Anspannung, Getriebenheit, Überforderung
- Untererregung: Lähmung, Rückzug, Erschöpfung, Gefühlstaubheit. Beides raubt uns Selbstwirksamkeit.
Wir funktionieren nur noch – verlieren aber das Gefühl, unser Leben gestalten zu können. Viele Menschen kompensieren diesen inneren Mangel durch Scheinlösungen:
Sie kontrollieren, leisten, funktionieren. Nach aussen wirkt alles stabil – doch innen ist der Kontakt abgebrochen. Und irgendwann meldet sich der Körper. Oder die Seele. Wege in eine gesunde Selbstregulation ist keine angeborene Eigenschaft, sondern eine entwickelbare Fähigkeit. Und sie braucht Geduld und bewusste Zuwendung.
Hier einige Kernelemente, um dein Nervensystem langfristig zu stärken:
- Basale Selbstfürsorge
- Schlaf
- Ernährung
- Bewegung
- Beziehungen
Klingt banal? Ist es nicht. Diese Grundbedürfnisse schaffen die Basis für emotionale und körperliche Stabilität.
- Bewusstsein für die eigene Innenwelt entwickeln.
- Achte auf dich – ohne zu bewerten:
- «Wie geht es mir gerade?»
- «Was fühle ich?»
- «Was denke ich?»
- «Wo spüre ich etwas in meinem Körper?»
- Kompensationsstrategien erkennen.
- Welche Muster lenken dich ab?
- Arbeit,
- Medien,
- Essen,
- Perfektionismus?
Diese «Ersatzregulationen» bringen kurzfristige Erleichterung, führen aber langfristig weg von dir selbst. Bevor du sie loslassen kannst, braucht es innere Sicherheit und Alternativen.
- Ressourcen aktivieren
- Was nährt dich?
- Was bringt dich ins Spüren?
- Natur,
- Kreativität,
- Bewegung,
- Musik,
- Stille,
- Begegnung ?
In einer Welt, die uns oft nach aussen zieht, ist Selbstregulation der stille Weg zurück nach innen. Zurück zu mir. Zu dem Ort, an dem ich mich halten kann – ohne mich zu verlieren.
Fazit
Beschwerden, welche über den Körper sichtbar werden, sind eine Einladung. Eine Einladung, genauer hinzusehen, wie wir leben, fühlen und handeln. Die Individualpsychologie bietet dafür einen wohlwollenden Rahmen: Sie versteht den Menschen als Ganzes und ermutigt dazu, Symptome nicht nur zu bekämpfen, sondern als Wegweiser zu deuten. Wenn dein Körper spricht, dann hör ihm zu. Er ist nicht dein Gegner, sondern dein Verbündeter und zeigt dir, wo Veränderung möglich ist.
Quellen (zur Vertiefung):
- Alfred Adler: Praxis und Theorie der Individualpsychologie, Anaconda Verlag, 2012
- Verena König: Bin ich traumatisiert? , Knaur.Leben ,2023
- Deb Dana: die Polyvagaltheorie in der Therapie, G.P.Probst Verlag GmbH, 3.Auflage 2021
Autorin:
Lisa Werthmüller, Dipl. individualpsychologische Beraterin AFI in eigener Praxis in Bern.
Lisa Wertmüller kennt und schätzt die Individualpsychologie seit ihrer Ausbildung an der Akademie für Individualpsychologie. Sie arbeitet in eigener Praxis in Bern mit den Schwerpunkten «Elterncoaching/Familienberatung», «Coaching für pädagogische Fachpersonen», «Elterntrainings-/Kurse».
Berater/in finden oder einen qualifizierten Abschluss in Individualpsychologie erwerben
Wünschst du dir Unterstützung bei der Bearbeitung deiner psychosomatischen Beschwerden oder möchtest du selber Menschen unterstützen ihre psychosomatischen Beschwerten zu erkennen und zu bewältigen?
Ausbildung zum/zur individualpsychologischen Berater/in AFI
Die Akademie für Individualpsychologie (AFI) bietet eine 3-jährige berufsbegleitende Ausbildung dazu an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den eidgenössisch anerkannten Titel «Berater/in im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom HFP» zu erwerben. Eine Anerkennung durch den Berufsverband mit dem Qualitätslabel psychosoziale/r Berater/in SGfB steht nach der Ausbildung ebenfalls offen.
Hier geht es zum nächsten Infoanlass
Berater/in finden
Hier findest du individualpsychologische Berater/innen in deiner Region.
INFOVERANSTALTUNG BESUCHEN
BROSCHÜRE HERUNTERLADEN
EINBLICK INS STUDIUM – STUDIERENDE BERICHTEN